Der Dom zu Gurk

- hochgeladen von Heinrich Moser
Der Dom zu Gurk wurde zwischen 1140 und 1200 im romanischen Stil erbaut.
Die erste urkundliche Erwähnung stammt aus dem Jahr 1162.
Der fränkische Kaiser Arnulf von Kärnten schenkte 898 dem schwäbischen Edlen Zwentibold, einem Vorfahren der Hemma von Gurk, Güter im Gurk- und Metnitztal, darunter einen Hof in Gurk. Diese Besitztümer erbte Hemma in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Sie ließ in Gurk die Johanneskirche erbauen, für die sie 1043 beim Salzburger Erzbischof Baldwin Pfarrrechte erwirkte. Sie stiftete im selben Jahr ein Nonnenkloster mit eigener Marienkirche. Das Frauenkloster in Gurk wurde schon im Jahr 1070 aufgelöst, nachdem der Erzbischof Gebhard von Papst Alexander II. die Erlaubnis erhalten hatte, in Kärnten ein Bistum zu gründen. Der mit dem Kloster verbundene Besitz kam so in Salzburger Besitz und 1072 gründete der Erzbischof das Suffraganbistum Gurk, ein Bistum ohne eigene Diözese und ohne Domkapitel. Als erster Bischof wurde Günther von Krappfeld geweiht.
Die Krypta unter Chor und Querhaus wurde 1174 als erster Teil des Domes fertiggestellt und war wohl von Beginn an der Verehrung Hemmas gewidmet. Nach Hartwagner ist sie „der großartigste Kryptenbau des deutschen Sprachraumes“[7]. Die Krypta misst rund 20 x 20 Meter und ragt rund 1,75 Meter aus dem Boden. Betreten wird sie über zwei Treppen von der Oberkirche aus. Die 100-säulige Krypta besteht genau genommen aus 96 schlanken Säulen und zwei Doppelsäulen vor der Apsis (die Nebenapsiden fehlen in der Krypta). Die Säulenbasen sind mit Eckknollen, Blättern und figuraler Eckzier geschmückt, die Kapitelle sind jedoch einfache, schmucklose Würfelkapitelle. Daneben gibt es sechs rechteckige Stützpfeiler. Über den Säulen erhebt sich ein steiles, hohes Kreuzgratgewölbe.
Am Südostpfeiler befindet sich das Grab der heiligen Hemma, die seit 1174 in der Krypta bestattet ist. Der ursprüngliche schmucklose Steinsarg stand anfänglich an anderer Stelle auf sechs Tragsäulen, von denen drei erhalten sind. Die Säulen zeigen fremdartige Gesichte: zwei Frauen und einen Mann. Unter dem Sarkophag krochen Frauen durch, um Kindersegen zu erbitten. 1721 ließ Propst Kochler von Jochenstein den Sarg mit rotem Marmor verkleiden, um diesen Brauch abzustellen. Weiters ließ er vom Italiener Antonio Corradini ein Marmorrelief mit Hemmas Tod und zwei seitliche Marmor-Figuren, die Allegorien von Glaube und Hoffnung anfertigen. Bemerkenswert ist die Figur des Glaubens mit ihrem verschleierten Gesicht. 1925 wurde ein Teil der roten Marmorverkleidung entfernt, sodass die romanischen Säulenköpfe wieder sichtbar sind. Die Mauern über dem Grab sind mit zartem Rankenstuck verziert. Das Grab ist von einem schmiedeeisernen Gitter umgeben. In der Ecke befindet sich der legendäre Hemma-Stein aus Chloritschieferstein. An den Wänden befinden sich – meist auf Blech gemalte – Votivtafeln.
Quelle: Wikipedia
http://de.wikipedia.org/wiki/Dom_zu_Gurk
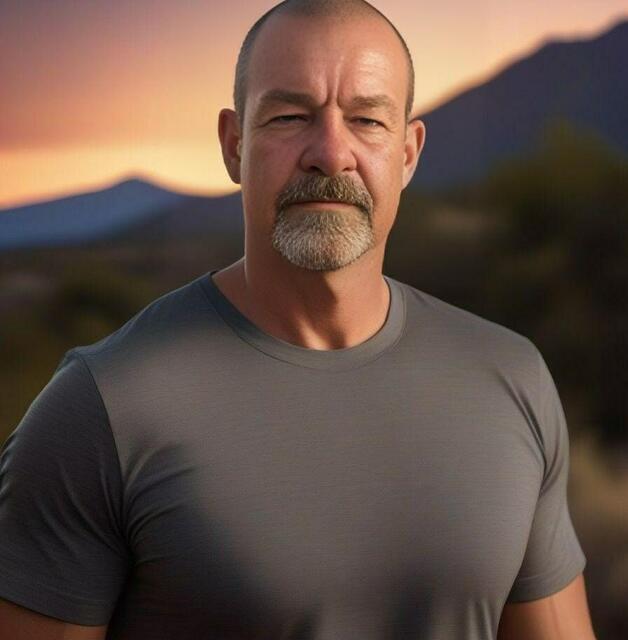










 Du willst eigene Beiträge veröffentlichen?
Du willst eigene Beiträge veröffentlichen?
Du möchtest kommentieren?
Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.