"Menschliche" Redewendungen!
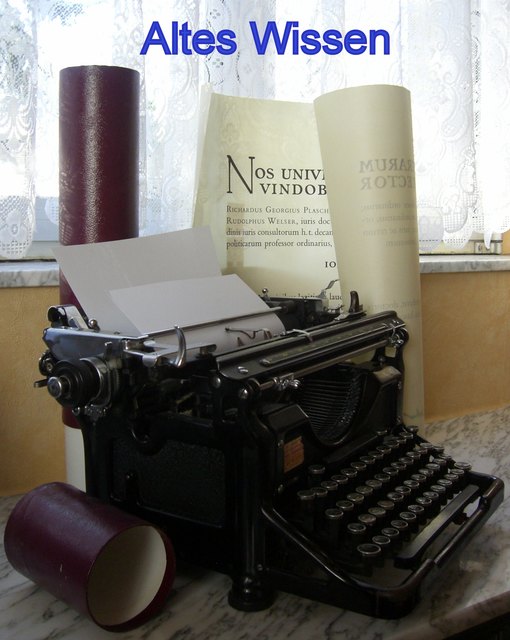
- hochgeladen von Gerhard Woger
Ein Bäuerchen machen!
Bedeutung:
Meist bei Babys: aufstoßen, rülpsen
Herkunft:
Diese Redensart kommt aus dem Mittelalter, als es noch üblich war, in aller Öffentlichkeit zu schmatzen, rülpsen oder auch einmal einen fahren zu lassen. Martin Luther (1483-1546) sagte einmal: „Warum rülpset und furzet ihr nicht? Hat es euch nicht geschmecket?“
Doch irgendwann begann man, sich vornehmer zu verhalten. Um sich von den groben, ungeschliffenen Bauern abzugrenzen, begannen im 19. Jahrhundert die bürgerlichen Schichten in den Städten Verhaltensweisen von den Adligen abzuschauen.
Außer für die Babys wurden diese Körpergeräusche zum Tabu. Auch damals schon wusste man, dass für Säuglinge das Rülpsen unerlässlich und wichtig für die Verdauung ist. Außerdem klappt bei Säuglingen das Zusammenspiel von Luft- und Speiseröhre noch nicht fehlerfrei, so dass regelmäßiges Aufstoßen unvermeidbar ist. Um es etwas zu verniedlichen, nannte man die Rülpser der Babys von nun an entschuldigend „Bäuerchen“, also „kleiner Bauer“. Denn nur Babys – und rüpelhaftes Bauernpack – dürfen ungestraft in der Öffentlichkeit rülpsen.
Hand und Fuß haben!
Bedeutung:
Etwas ist gut durchdacht, ein solides Vorhaben, etwas ist vertrauenswürdig.
Herkunft:
Diese Redensart entwickelte sich im Mittelalter. Ein intakter Körper hieß volle Belastbarkeit und Tauglichkeit. In dieser Zeit bedeutete das Abhacken eines der Gliedmaßen eine Einschränkung, wurde sogar die rechte Hand und der linke Fuß entfernt, bedeutete das die komplette Hilflosigkeit für einen Mann: Er konnte weder ein Pferd besteigen noch ein Schwert führen. Dementsprechend war dies oftmals eine schwerwiegendere Strafe als beispielsweise die Todesstrafe. Doch schon seit dem 16. Jahrhundert setzte sich die Redensart im Sinne der Tauglichkeit eines Unternehmens oder eines Vorhabens durch.
Daumen drücken!
Bedeutung:
Jemandem Glück wünschen, jemandem gutes Gelingen bei einer Sache wünschen
Herkunft:
Für diese Redensart gibt es zwei mögliche Ursprünge: Im alten Rom haben die Gladiatoren, die den Kampf verloren hatten, durch einen gehobenen Zeigefinger das Publikum um Gnade gebeten. Wollte es den Tod des Gladiators, streckte die Menge die Daumen aus. Signalisierte sie die Begnadigung, streckten sie die Faust mit eingezogenem Daumen aus, drückten den Daumen also.
Den Daumen halten dagegen kommt aus dem deutschen Volks- und Aberglauben. Dort besaß laut Glauben der Daumen die meiste magische Kraft, galt als Glücksfinger und sollte vor bösen Träumen schützen. Der Daumen stand aber auch für das Symbol eines Koboldes und um den Daumen daran zu hindern, die Vorhaben eines anderen Menschen negativ zu beeinflussen, dem man eigentlich Glück wünschte, hielt man den eigenen Daumen, also den Kobold, mit den anderen Fingern fest.
Jemandem auf dem falschen Fuß erwischen!
Bedeutung:
Jemanden unvorbereitet erwischen, zu einem ungünstigen Zeitpunkt erscheinen.
Herkunft:
Diese Redewendung kommt aus dem Sport. Viele Sportler, besonders Fußballer und Tennis- oder Badmintonspieler haben ein „starkes“ Bein, das sie beim Abspielen stärker belasten und mit diesem Bein stärker schießen können oder einen festeren Stand haben. Erwischt man sie auf dem „falschen Fuß“, fällt das Ergebnis schwächer aus. Auch Nicht-Sportler kann man auf dem „falschen Fuß“ erwischen – zum Beispiel, wenn jemand nicht vorbereitet ist oder vergessen hat, seine Hausaufgaben zu machen.
Jemanden übers Ohr hauen!
Bedeutung:
Jemanden übers Ohr hauen – jemanden betrügen, übervorteilen
Herkunft:
Diese Redewendung hat ihren Ursprung im Fechtsport und bedeutete früher „jemanden mit der Waffe am Kopf oberhalb der Ohren treffen“. Dabei wird dem Gegner aus der Defensive heraus mit einem gezielten Hieb übers Ohr geschlagen. Der schmerzhafte Schlag über die Ohrenlinie gilt in der Fechtkunst als äußerst unfein und unverschämt, erfordert aber auch ein Mindestmaß an Geschicklichkeit, so dass dem Angreifer früher und dem Empfänger der Redewendung heute auch etwas Anerkennung zuteil wird.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge!
Bedeutung:
Etwas mit gemischten Gefühlen betrachten, etwas besitzt Vor- und Nachteile, nicht wissen, ob man sich freuen oder weinen soll!
Herkunft:
Diese Redewendung stammt vermutlich aus Shakespeares Drama „Hamlet“. Darin verkündet der König, dass sein Bruder gestorben sei, er selbst aber nun dessen Witwe heiraten werde: „Wir haben also unsre weiland Schwester … mit einem heitren, einem nassen Aug … zur Eh genommen“. Ob dies aber wirklich der Ursprung dieser Redewendung ist oder nur der Anlass der Verbreitung, bleibt ungeklärt.
Vor Neid platzen!
Bedeutung:
Sehr neidisch sein auf jemanden!
Herkunft:
Die Herkunft dieser Redewendung ist nicht sicher belegt. Vielleicht stammt sie von der Geschichte des römischen Fabeldichters Phaedrus. In dieser Fabel trifft ein Frosch auf einer grünen Wiese auf eine Kuh. Neidisch auf ihre Größe plustert der Frosch seine Backen auf, aber natürlich kommt er nicht an die Größe der Kuh heran. Allerdings ist der Frosch störrisch und will seine Niederlage nicht einsehen, und so pumpt er immer mehr Luft in seinen kleinen Körper hinein, bis er plötzlich mit einem lauten Knall platzt. Ist jemand auf etwas oder jemanden anderes neidisch, besteht die Gefahr des Platzens zwar nicht wirklich, aber manchmal steigert man sich so in dieses Gefühl hinein, dass man buchstäblich platzen könnte vor Neid.
Asche auf mein Haupt!
Bedeutung:
Sagt man die Redewendung „Asche auf mein Haupt“, gesteht man seine eigene Schuld ein. Manchmal wird sie aber ironisch verwendet.
Herkunft:
Asche gilt als Zeichen der Trauer, Buße und Umkehr und symbolisiert besonders im christlichen Zusammenhang Neuanfang und seelische Reinigung. Dafür steht ebenso der Aschermittwoch. Dieser hat seinen Namen durch einen alten christlichen Brauch erhalten: Menschen, die eine Sünde begangen hatten, trugen ab diesem Tag bis Ostern Bußkleider, wurden mit Asche bestreut und symbolisch aus der Kirche geworfen. In den nächsten 40 Tagen erhielten die Sünder die Gelegenheit, Buße zu tun und ihre Taten zu bereuen. Am Gründonnerstag nahm die Gemeinde sie wieder in ihrem Kreis auf. Der Brauch der allgemeinen Aschebestreuung gibt es seit dem 11. Jahrhundert. Jedem Christen – Sünder oder nicht – wird am Aschermittwoch ein Kreuz aus geweihter Asche auf die Stirn gezeichnet.
Kalte Füße kriegen!
Bedeutung:
Diese Redensart wird benutzt, wenn sich jemand aus einer unangenehmen Situation befreien will.
Herkunft:
Buchstäblich kalte Füße bekommt man, seit es das Glücksspiel gibt. Früher waren Glücksspiele verboten, und so zog man sich zum Kartenspielen um Geld in die Kellerräume zurück. Dort wurde nicht geheizt und es war somit meist recht kalt. Dies wurde von Spielern, die ein schlechtes Blatt hatten, als Ausrede genutzt, um aus dem Spiel auszusteigen: „Ich hab so kalte Füße, ich geh jetzt mal lieber“..
Schlitzohr!
Bedeutung:
Ein Schlitzohr sein / schlitzohrig sein – ein gerissener, schlauer, gewiefter, durchtriebener, listiger Mensch
Herkunft:
Zur Herkunft von Schlitzohr gibt es mehrere Deutungen. Zum einem sagt man, dass der Begriff schon aus dem Mittelalter stammt, wo man Betrüger durch das Schlitzen des Ohres bestrafte und so auch als Betrüger kenntlich machte. Andere Quellen bestreiten dies, denn früher seien den Betrügern die Ohren abgeschnitten, nicht nur geschlitzt worden. Möglicherweise hielt man ein Schlitzohr auch für eine mit dem Teufel im Bunde stehende Person, denn diesen stellte man sich schlitzohrig und schlitzfüßig vor.
Weiter heißt es, dass das Wort Schlitzohr seit dem 19. Jahrhundert verbreitet wurde. Zimmerleute oder Handwerker, die auf Wanderschaft waren, trugen einen goldenen Ohrring mit dem Wappen ihrer Zunft. Dieser war der einzig angesparte Reichtum, diente als Notgroschen, als Gewähr für ein Begräbnis und ließ sich ein Geselle etwas zuschulden kommen oder wurde sogar straffällig, rissen seine Kameraden ihm den Ohrring heraus, machten ihn so zum Schlitzohr und spätere Arbeitgeber und Meister waren gewarnt.


 MeinBezirk auf
MeinBezirk auf MeinBezirk als
MeinBezirk als 

Du möchtest kommentieren?
Du möchtest zur Diskussion beitragen? Melde Dich an, um Kommentare zu verfassen.